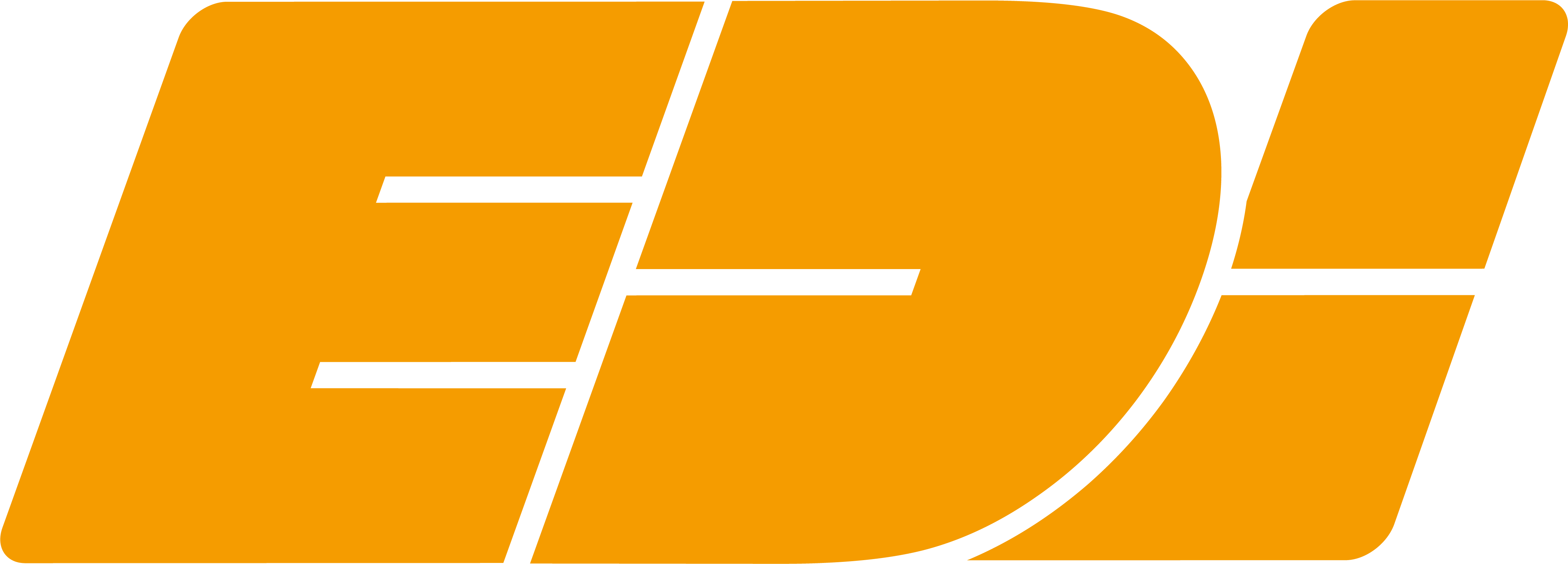Leitfaden für Planung und Bau Ihres Pelletlagers
Das optimale Lager für Holzpellets

Ein Pelletlieferant bei der Befüllung eines Sacksilos. Foto: © Deutsches Pelletinstitut
Die richtige Planung und Einrichtung eines Pelletlagers ist entscheidend für die effiziente, emissionsarme und störungsfreie Nutzung Ihrer Pelletheizung. In diesem Blogbeitrag bieten wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte, die Sie bei der Planung und dem Bau eines Pelletlagers laut dem DEPI – Deutsches Pelletinstitut beachten sollten. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, ein sicheres, gut zugängliches und effizientes Lager zu erstellen, das Ihnen langfristig Kosten und Mühen erspart.
Warum eine sorgfältige Planung entscheidend ist
Seit der Einführung von Pelletkesseln vor rund 20 Jahren hat sich die Technik erheblich weiterentwickelt. Fachkundige Planung ist essenziell, um sicherzustellen, dass Ihr Pelletlager optimal funktioniert und Ihre Heizung effizient betreibt. Die Planung sollte immer von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, wie sie vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) empfohlen werden. Diese Experten tragen das Siegel „Pelletfachbetrieb“ und garantieren eine fachgerechte Planung und Ausführung.
Wichtige Faktoren bei der Planung eines Pelletlagers
Größe des Lagers: Ihr Pelletlager sollte groß genug sein, um den gesamten Jahresbedarf an Pellets zu fassen. Das reduziert die Anzahl der Lieferungen und ermöglicht es Ihnen, von günstigeren Preisen in der Nebensaison zu profitieren. Der Platzbedarf hängt vom Wärmebedarf Ihres Hauses ab. Als Faustregel gilt, dass der Raum, in dem früher der Öltank stand, oft ausreichend ist.
Lage und Zugänglichkeit: Das Lager sollte so positioniert sein, dass die Wege vom Lieferfahrzeug zum Lager und vom Lager zum Kessel möglichst kurz und gerade sind. Dies minimiert den Staub und die Feinanteile, die beim Transport der Pellets entstehen können. Achten Sie darauf, dass der Stellplatz für das Lieferfahrzeug gut zugänglich ist und dass die Zufahrtswege den Anforderungen bezüglich Gewicht und Wendekreis der Fahrzeuge entsprechen.
Befüllsysteme und deren Anforderungen
Das Befüllsystem spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Qualität der Pellets zu erhalten. Es sollte so gestaltet sein, dass die Pellets schonend eingeblasen werden. Die Befüllleitungen sollten kurz und mit möglichst wenigen Richtungsänderungen versehen sein. Die Einblasstrecke sollte nicht länger als 30 Meter sein, um die Pellets nicht zu beschädigen.
Einbau von Befüllkupplungen: Diese sollten maximal 2 Meter über dem Boden angebracht werden, um ein sicheres Ankoppeln der Schläuche zu ermöglichen. Idealerweise werden sie an Außenwänden montiert, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Bei Inneninstallationen muss ein ausreichender Arbeitsraum um die Kupplungen herum freigehalten werden.
Arten von Pelletlagern
Heutzutage stehen verschiedene Typen von Pelletlagern zur Verfügung, die sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet sind:
- Gewebesilos: Diese luftdurchlässigen Silos sind für Innenbereiche geeignet und erfordern eine gute Belüftung des Aufstellraums.
- Fertiglager aus Kunststoff oder Metall: Diese sind luftundurchlässig und benötigen während des Befüllens eine Absaugung der Luft. Sie eignen sich besonders für feuchte Kellerräume.
- Erdvergrabene Lager: Diese Lager aus Kunststoff oder Beton bieten eine platzsparende Lösung für Außenbereiche.
Austrags- und Fördersysteme
Diese Systeme transportieren die Pellets vom Lager zum Heizkessel. Es gibt mechanische Austragssysteme, die mit Förderschnecken arbeiten, und pneumatische Systeme, die Pellets mit Saugköpfen oder Saugsonden befördern. Eine Kombination aus beiden Systemen ist ebenfalls möglich. Wichtig ist, dass diese Systeme die Pellets schonend und effizient fördern und bei Störungen leicht zugänglich sind.
Statische Anforderungen und Belüftung
Ein Pelletlager muss den Gewichtsdruck der Pellets sowie die Druckunterschiede beim Einblasen aushalten. Es muss entsprechend den statischen Anforderungen geplant und gebaut werden.
Belüftung: Pellets können Kohlenmonoxid (CO) freisetzen, daher ist eine ständige Belüftung wichtig. Belüftende Deckel an den Befüll- und Absaugstutzen sorgen für eine ausreichende Luftzufuhr. Vor dem Betreten des Lagers sollte es mindestens 15 Minuten gut durchgelüftet werden. Bei großen Lagern oder solchen, die erdvergraben sind, ist ein CO-Warngerät erforderlich.
Brandschutzmaßnahmen
Die Lagerung von Holzpellets unterliegt bestimmten Brandschutzanforderungen, die je nach Bundesland variieren können. In der Regel ist bei Lagern unter 6,5 Tonnen kein spezieller Brennstofflagerraum erforderlich. Die genauen Bestimmungen können bei den jeweiligen Landesfeuerungsverordnungen nachgelesen werden.
Lagerung von Sackware
Sackware sollte trocken und vor UV-Strahlung geschützt gelagert werden. Ideal sind gut belüftete Räume, in denen die Pellets nicht mit feuchten Wänden oder Böden in Berührung kommen. Paletten sind eine gute Möglichkeit, die Säcke trocken zu halten. Öffnen Sie nur die Säcke, die Sie direkt verbrauchen, um die Emissionen gering zu halten.
Fazit
Die Planung und der Bau eines Pelletlagers erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Vorbereitung. Von der Größe und Lage des Lagers über die Wahl des Befüllsystems bis hin zu den statischen und brandschutztechnischen Anforderungen gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen. Mit der richtigen Planung können Sie sicherstellen, dass Ihr Pelletlager effizient und sicher ist und Sie langfristig Kosten und Mühen sparen.
Quelle: Text, Fotos und Lager-Konfigurator von DEPI – Deutsches Pelletinstitut